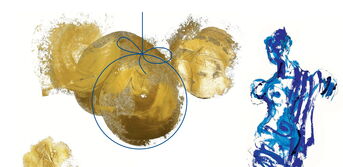Achtung Vollzugsverbot: Frühstart beim Unternehmenskauf vermeiden!
Für den Unternehmenskäufer ist es sehr riskant, bereits vor der Freigabe eines Zusammenschlusses Einfluss auf das Zielunternehmen zu nehmen. In einem aktuell veröffentlichten Urteil hat das Europäische Gericht (EuG) eine Geldbuße der EU-Kommission von 124,5 Millionen Euro gegen das Telekommunikationsunternehmen Altice Europe im Wesentlichen bestätigt (EuG, Urteil vom 22.09.2021, Az. T-425/18).
Hintergrund ist, dass Altice - ein multinationales Telekommunikationsunternehmen – versucht hatte, über Aktienkäufe die Kontrollmehrheit an der PT Portugal - einem Telekommunikations- und Multimediabetreiber mit Tätigkeiten in sämtlichen Telekommunikationssparten Portugals - zu erlangen. Nach vorbehaltlicher Fusionsgenehmigung der
Kommission im April 2015 erfolgte eine Prüfung des Vorgangs hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Fusionskontrollverordnung. Hinweise hätten ergeben, dass eine Kontrolle über PT Portugal bereits bei Anmeldung des Zusammenschlusses bestanden habe.
Ist bei einer M&A-Transaktion ein Fusionskontrollverfahren erforderlich, sei es beim Bundeskartellamt oder bei der EUKommission, dauert es manchmal Wochen oder Monate bis zum Closing, also bis der bereits unterzeichnete Unternehmenskaufvertrag vollzogen werden kann. Bis zur kartellrechtlichen Freigabe darf die Transaktion von Gesetzes wegen und unter Bußgeldandrohung nicht vollzogen werden, was vor allem auch bedeutet, dass der Käufer keinen bestimmenden Einfluss auf das Zielunternehmen ausüben oder es gar schon in den eigenen Konzern integrieren darf.
Das Dilemma des Käufers ist offenkundig: Obwohl er das Zielunternehmen noch nicht kontrolliert, trägt er bereits das wirtschaftliche Risiko. Zulässig sind im Wesentlichen nur Regelungen im Kaufvertrag, die sicherstellen, dass das Zielunternehmen keine außergewöhnlichen Maßnahmen ergreift und nicht an Wert verliert. In der Regel wird dazu im Kaufvertrag vereinbart, dass der Verkäufer das Zielunternehmen bis zum Vollzug nur in der bisherigen Weise fortführen darf und einzelne Maßnahmen, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs liegen, nur mit Zustimmung Käufers erfolgen dürfen. Schon hier gibt es rechtliche Unsicherheiten, weil unklar ist, wo genau die Grenzen zulässiger Einflussnahme verlaufen. Dies muss im konkreten Einzelfall abgewogen werden.
Letztlich dürfen weder die vertraglichen Regelungen noch das Verhalten der Unternehmen zu einem Frühstart führen, dem sog. „gun jumping“. Im Fall Altice / PT Portugal wurde das zulässige Maß nach Feststellung des Gerichts überschritten: Die Nebenabreden, aufgrund derer Altice berechtigt gewesen sei, die höheren Führungskräfte von PT Portugal zu bestellen und zu entlassen oder ihre Verträge abzuändern und sich in die Preispolitik einzumischen, hätten Altice einen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftspolitik des übernommenen Unternehmens gesichert. Es sei zudem aktenkundig, dass tatsächlich entsprechende Eingriffe stattgefunden hätten und sensible Informationen zwischen Altice und PT Portugal ausgetauscht worden seien. Altice habe dadurch sowohl gegen ihre Anmeldepflicht nach Art. 4 Abs. 1 der Fusionskontrollverordnung als auch gegen ihre Stillhaltepflicht nach Art. 7 Abs. 1 dieser Verordnung verstoßen.
Das Urteil bekräftigt, dass sich der Käufer bis zur kartellrechtlichen Freigabe zurückhalten und muss keinen Einfluss auf den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Zielunternehmens nehmen darf. Gemeinsame Vertragsverhandlungen mit Geschäftspartnern des Zielunternehmens sind unzulässig, ebenso natürlich Maßnahmen, die nur ein
beherrschender Gesellschafter durchführen kann, wie z.B. der Wechsel der Geschäftsführung.
Beim Unternehmenskauf ist also in der Phase zwischen Signing und Closing das Spannungsverhältnis zwischen Vollzugsverbot und Erhalt des Werts des Zielunternehmens also vorsichtig auszuloten. Vertragliche Regelungen im Unternehmenskaufvertrag dürfen sicherstellen, dass das Zielunternehmen bis zum Closing in bisheriger Weise weitergeführt wird. Alles andere birgt das Risiko eines unzulässigen Frühstarts, welcher im Unterschied zum sportlichen Wettbewerb zwar nicht die Disqualifikation, aber beträchtliche Bußgelder zur Folge haben kann.
Für die rechtliche Begleitung Ihrer M&A-Projekte steht Ihnen unser Unternehmensrechts-Team (RA Dr. Theodor Seitz, RA Urs Lepperdinger, RAin Sandra Hollmann und RA Dr. Christoph Knapp) gerne zur Verfügung.